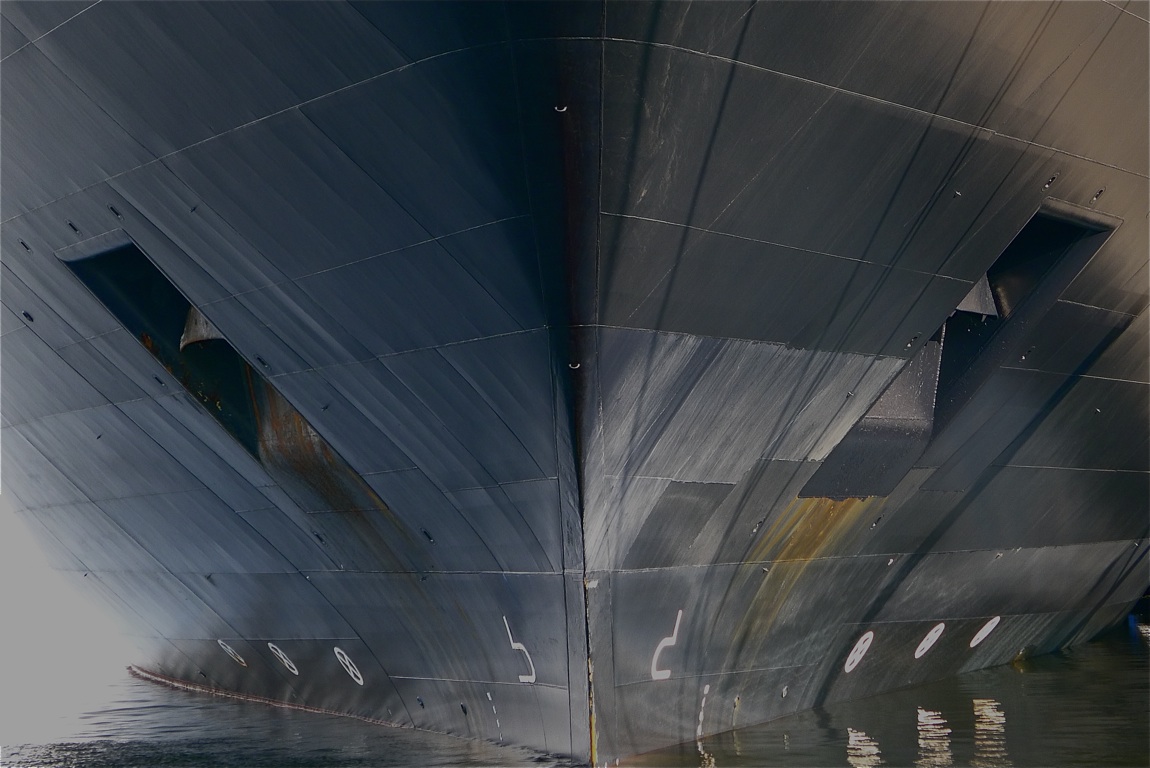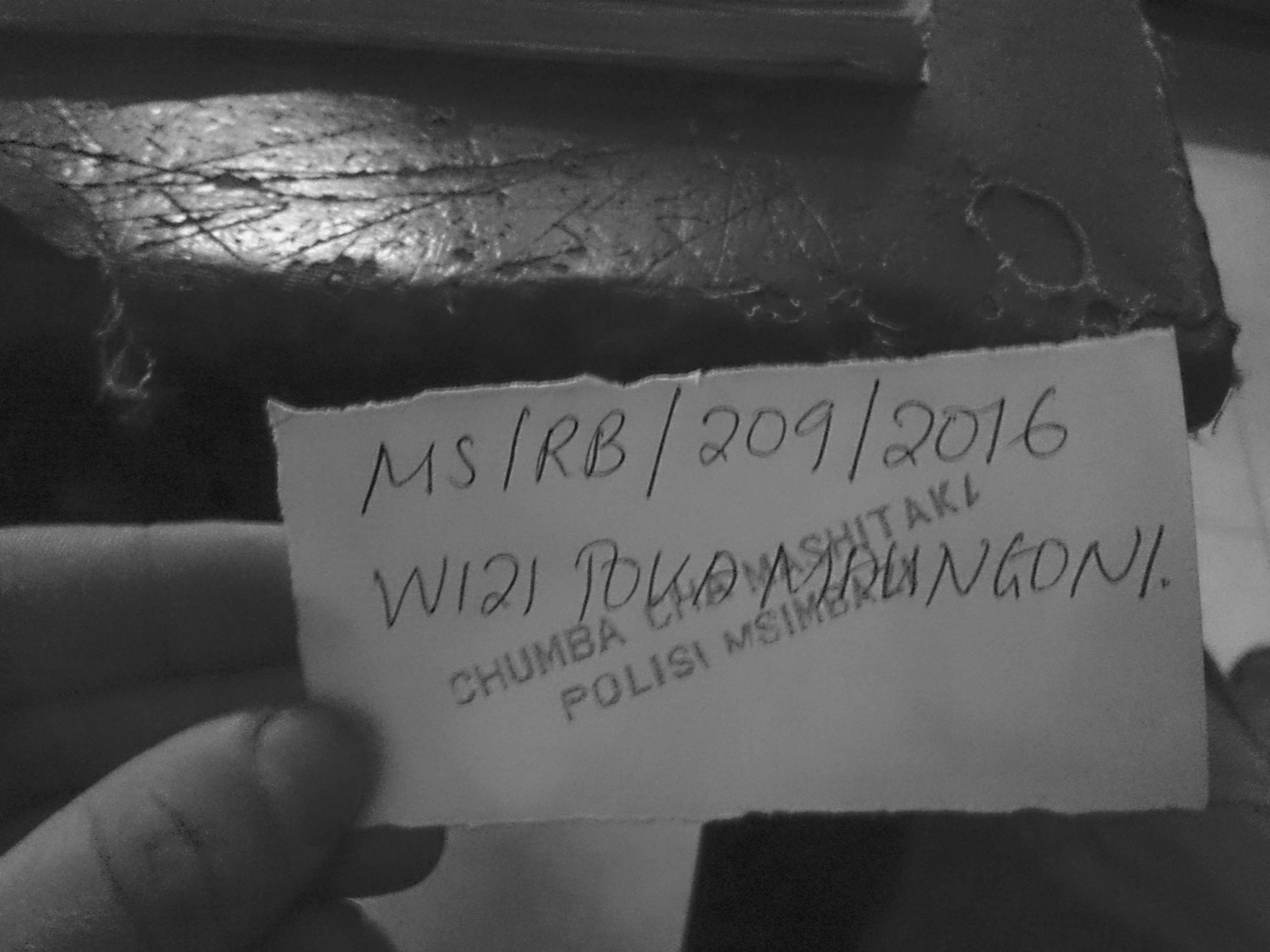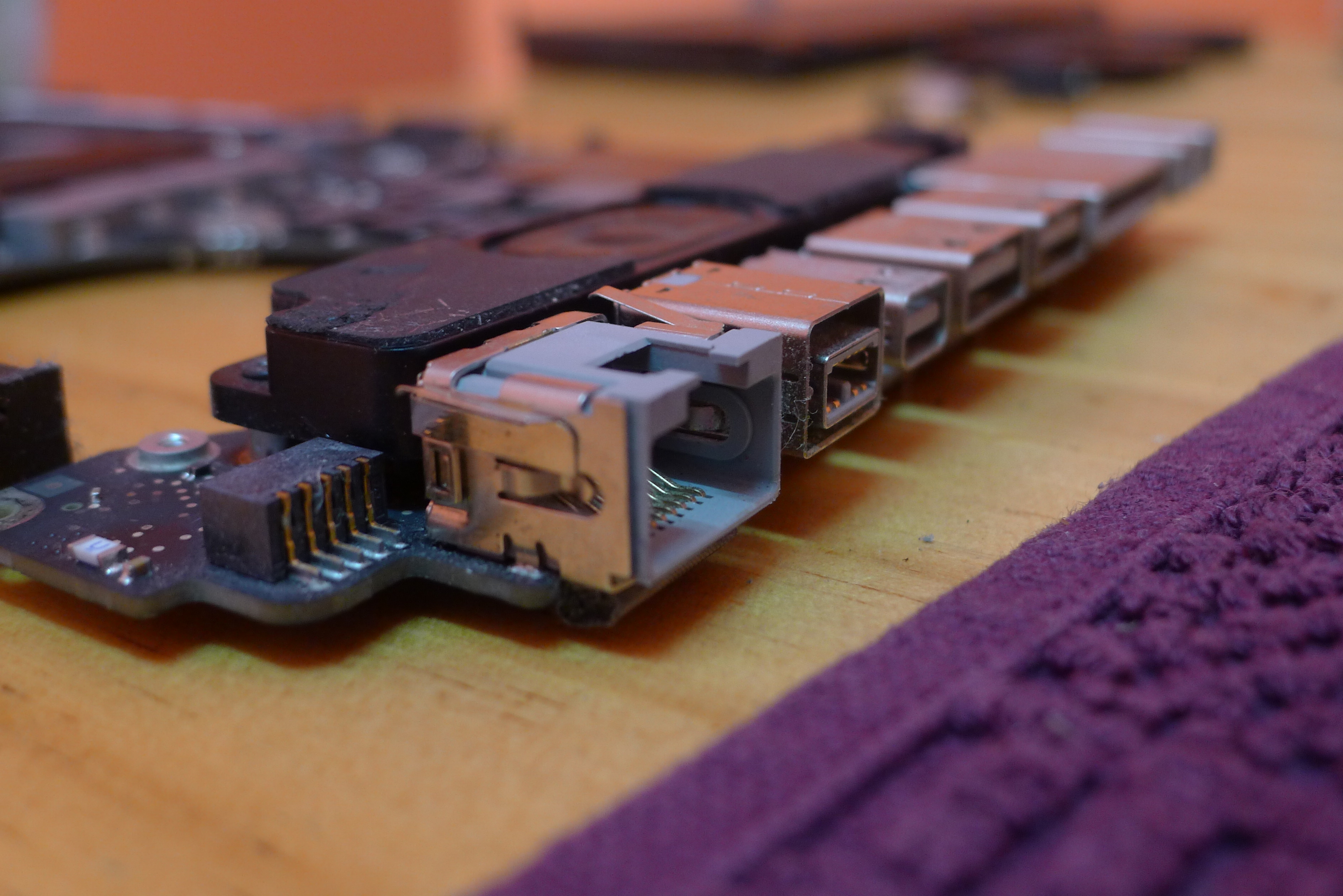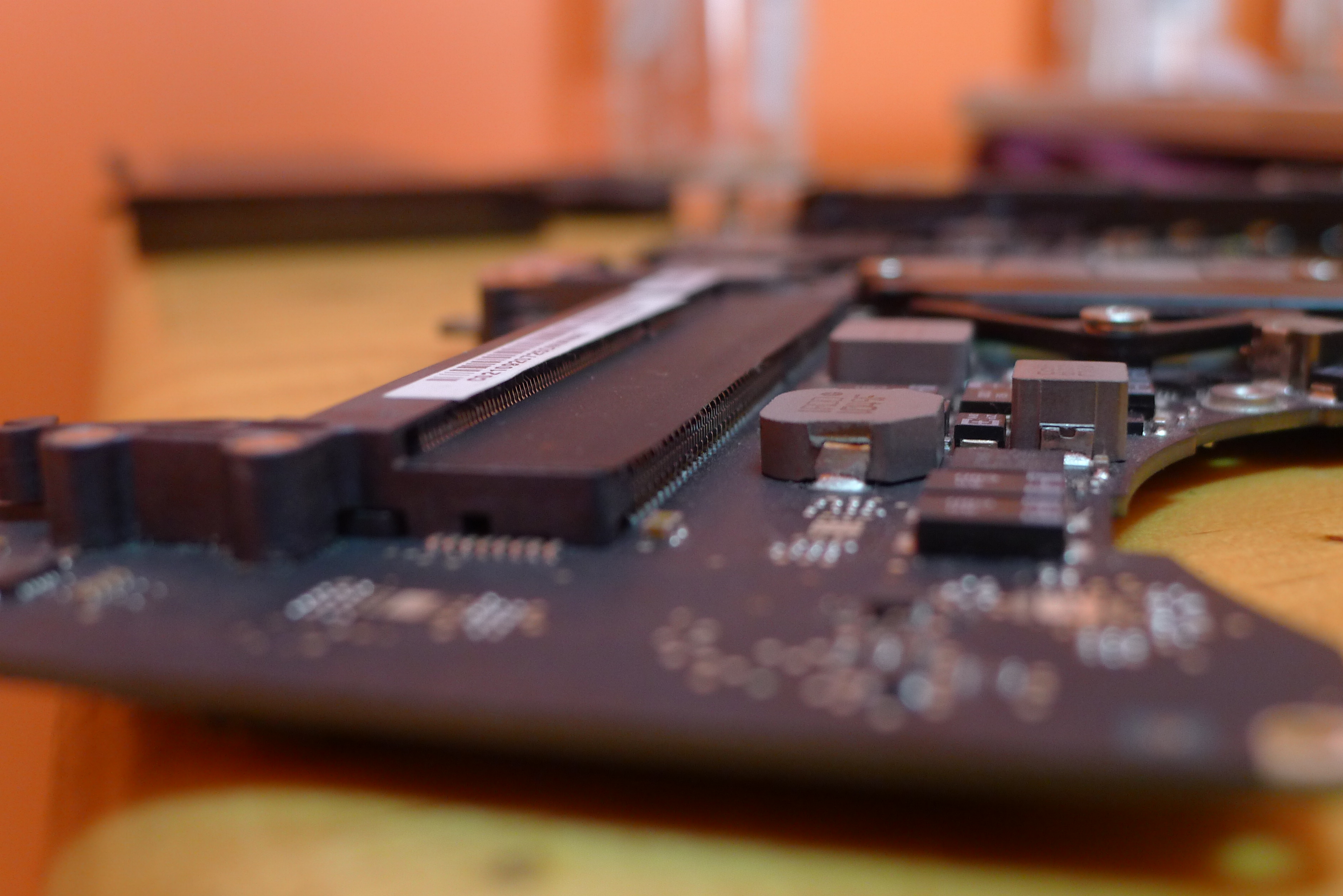Gestern hat G. eine Nachricht von einem bekannten tansanischen Musiker bekommen. Dieser kennt Gs. Chef, der wiederum den Kontakt zwischen den beiden hergestellt hat. Dieser lud ihn ein zu einem Konzert mit seinem neuesten Lied „Najaribu“ (I am trying). Endlich, dachte sich G., der den halben Tag im Immigration Office herumgesessen hatte, um endlich die dringend benötigt Visumsverlängerung zu bekommen – immerhin erfolgreich. Er sagte seinen Mitfreiwilligen Bescheid und ein paar anderen Freunden. Er meinte, es wäre wohl gut, sich um acht Uhr am Paparazzi-Club in Masaki zu treffen, er würde auch da sein. Nachdem sich das Video für seine Kamera-Spendenkampagne noch sehr hinzog, kam er schließlich um halb zehn im nächtlichen Masaki an, die Freunde warteten schon. G. gibt nicht so gerne Eintrittsgebühren aus, auch wenn es nur 10.000 Shilling für ein vermutlich sehr gutes Konzert sind. Also sagte er zur Ticketverkäuferin, sie seien Freunde von M., der an diesem Abend auftreten würde, was ja auch halbwegs stimmte, immerhin hatten sie schon telefoniert. Die Verkäuferin fragte, ob sie schon auf der Gästeliste seien. G. sagte: Noch nicht. Die Verkäuferin hielt G. die Gästeliste hin, wo er seinen Namen und die seiner Freunde in der Handschrift der Person hinschrieb, die schon andere Namen auf die Liste gekliert hatte. Offenbar eine tolerante Gästelisten-Praxis. Aber ohnehin hat G. den Snobismus, der in Bezug auf Gästelisten in Deutschland teilweise herrscht, in Tansania bisher nicht erlebt und auch nicht vermisst.
Die Bar war krass. Sie hätte überall in der westlichen Welt sein können. Es hingen keine Lampen an halb abgerissenen Kabeln von der Decke. Die Toiletten waren sauber, alle Kacheln waren sauber verfugt, die Metalloberflächen rostfrei. Die Klimaanlage sorgte für frostige Temperaturen – Nordhalbkugel. Es spielte eine Vorband. G. zog sein altes Nokia aus der Tasche, dass er wegen seines einsamen Heimwegs an Stelle des Smartphones dabei hatte und kam sich arm vor. Um ihn herum iPhones, Markenklamotten, Expats und Locals, die Whiskey tranken und Gin. G. bestellte eine Cola, einerseits wegen der Antibiotika, die er gegen eine Lymphknoten-Entzündung nahm, andererseits, weil Alkohol in teuren Clubs auch dem Budget von Weltwärts-Freiwilligen nicht besonders bekömmlich ist. Zwei Kolleginnen von Mi. aus Schweden waren auch da und G. hat sich gefreut, mit ihnen zu reden. Wenn er Schwedisch spricht, steht er wieder auf der Landstraße bei Ingelsbo, es hat zwanzig Grad, stahlblauer Himmel und es riecht nach Wald.
Dann lieh er sich Mis. Smartphone aus, um sich ein Bild von M., dem Musiker, anzuschauen, damit er ihn erkennen könnte. Aber er wurde dann auch von einem anderen bekannten Musiker angesagt, dem wohl einzigen bekannten weißen Musiker in Tansania, Mzungu Kichaa. Und die Musik, die dann kam, war wirklich Oberklasse. Selten hat G. so unbeschwert getanzt, ohne sich über den unfähigen DJ oder Mainstream-Musik zu ärgern. Nur der Tanzstil anderer Deutscher deutete daraufhin, welche Art von Musik diese normalerweise hörten, aber das war weit weg. Nach dem Konzert gelang es G., noch kurz mit M. zu reden. Vielleicht kann er über ihn eine Trompete ausleihen. Denn diese vermisst G. sehr. Das ist ihm klargeworden, als er morgens in Sansibar auf einem alten Fischerboot saß und auf den Wellen schaukelte. Ohne Musik geht es nicht.
Der Rückweg vom Konzert war theoretisch schön. Eine laue Nacht in einem schönem Villenviertel, Fahrrad fahren, bei einem Freund in der Firma in einem wirklich schönen Haus übernachten. Real ist das Problem in Masaki, dass es nachts zu den unsichersten Gegenden von Dar Es Salaam gehört. Die Villen haben hohe Mauern und Starkstrom-Zäune. Dahinter ist es sicher. Davor sitzen Wachleute, die im Zweifelsfall nur ihr Grundstück bewachen. Dazwischen liegen große, völlig verlassene Passagen. Die meisten davon sind wirklich verlassen, aber man weiß es nicht. G. schaltete in den höchsten Gang, Stirnlampe auf volle Helligkeit, Ausleuchtung bis hundert Meter. So raste er durch das menschenleere Masaki. Er verpasste die erste Abzweigung, die bei Nacht völlig anders aussah. Hielt an, fragte Wachleute nach dem Weg. Diese sahen ihn an, als wäre er verrückt. Ein Weißer allein nachts auf dem Fahrrad in Masaki. Erstens: Ein Weißer. Das perfekte Opfer für Straßenräuber. Zweitens: Allein. Drittens: Nachts. Viertens: Auf dem Fahrrad. Und dann noch in Masaki. Aber G. hatte in diesem Moment ja keine große Wahl. Er wusste die grobe Richtung und hoffte, dass ihn niemand anhalten würde. Rechts abbiegen, große Straße runter, wieder rechts, Allee, unübersichtlich. Schemen, in die Straßenmitte ziehen, nur ein Baum. Wieder auf der richtigen Straße, volles Tempo. In hundert Meter Entfernung drei Personen, keine Wachleute. G. geht davon aus, dass es nur sehr wenig Berufsräuber gibt. Aber wenn man wirtschaftlich armen Menschen eine Versuchung präsentiert, ist das dann nicht die Gelegenheit? Glücklicherweise schirmte ein entgegenkommendes Auto G. von der anderen Straßenseite ab, als er vorbeifuhr. So würde er nie erfahren, ob es nur drei Jungs auf dem Heimweg waren oder ob sie auf jemand warteten. Adrenalinspiegel oben fuhr G. weiter, er nahm den zweiten Abzweig, den er von den Straßenverhältnissen her als besser in Erinnerung hatte. Die erste Straße hat Pfützen über die ganze Breite und Sandsackdämme, über die man sein Fahrrad tragen muss, sind gefährliche Engstellen. Die zweite Straße führt durch ein Schulgelände. Das Tor war bis auf die Pforte zu. G. wollte auf keinen Fall anhalten, bog rechts ab und kam über eine dunkle Nebenstraße auf der Seite des Schulgeländes heraus. Rechts ein Wassergraben, links Baracken. G. fuhr mit vollem Tempo weiter, dann endete die Straße. Lichter aus, Fahrrad auf die Schulter. G. rannte durch den Sand zwischen den Baracken durch. Wenn alles voller Leute ist, strengt das an. Aber es ist auch sicher, weil immer jemand zur Stelle ist, wenn man Hilfe braucht. Hier war niemand. Glücklicherweise auch niemand Böswilliges. G. keuchte. Er kam beim zweiten Tor an. In der Straße war noch ein wenig Licht, Verkäufer schlossen ihre Geschäfte. Ein paar Männer saßen herum. Aber nachts sind die Bedingungen anders. Tags grüßt G. eine solche Gruppe freundlich, sie werfen sich ein paar Worte zu und die Männer grüßen ihn zurück. Nachts ruft G. „Salama! Usiku mwema!“, was soviel bedeutet wie „Sicher/Gut, Gute Nacht“ und die Männer antworten nicht. Oder sie antworten brummig, weil sie wissen, dass sie die Herren der Straße sind und G. ein Eindringling.
Mit voller Geschwindigkeit bretterte G. durch die Schlaglöcher, den tiefsten wich er aus, Gabel an der Belastungsgrenze. Er war seinem Fahrrad dankbar, dass es das mitmachte. Es ist ein altes Mountainbike, doch bei dieser Performance könnte es Paris-Roubaix mitmachen, das härteste Radrennen weltweit. Links abbiegen, Straße runter, hohe Mauern, rechts, dann war es geschafft. G. stand vor dem Tor, außer Atem, klopft, ruft dem Wächter zu. Er öffnete und G. dankte ihm. Im Haus angekommen, stellte sich G. erst einmal unter die Dusche. Wieder herunterkommen. Es war nichts passiert. Aber G. hatte sich unsicher gefühlt. Ob das objektiv berechtigt war, wusste er nicht. Aber es hatte in diesem Viertel schon viele Überfälle gegeben und außerdem warnte jeder vor der Gegend. Natürlich gibt es auch intersubjektive Vorurteile. Aber man sollte sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass solche Warnungen Vorurteile sind. Was er beim nächsten Mal tun würde, wusste er nicht. Vielleicht auf die anderen warten und hinter deren Bajaj (Ape-Taxi) hinterherfahren, bis er an einem nahen Punkt zu seinem Ziel war. Aber es würde immer gefährliche Stellen geben, solange man nicht permanent einen Fahrer hatte und selbst dann gäbe es die Gefahr, dass man an irgendeinen Ort gebracht würde. Einfach zu Hause bleiben? Dann lebt man nicht. Bisher war G. noch nichts Schweres zugestoßen, aber er wusste, wie sich ein Überfall anfühlt. Das wollte er nicht wieder erleben. Und doch war es besser, als in einem mentalen Bunker zu leben und sich irgendwann einen physischen zu wünschen. Er starrte an die Decke. Teakholz. Zumindest heute war darüber keine Entscheidung mehr zu treffen. Er schlief ein.