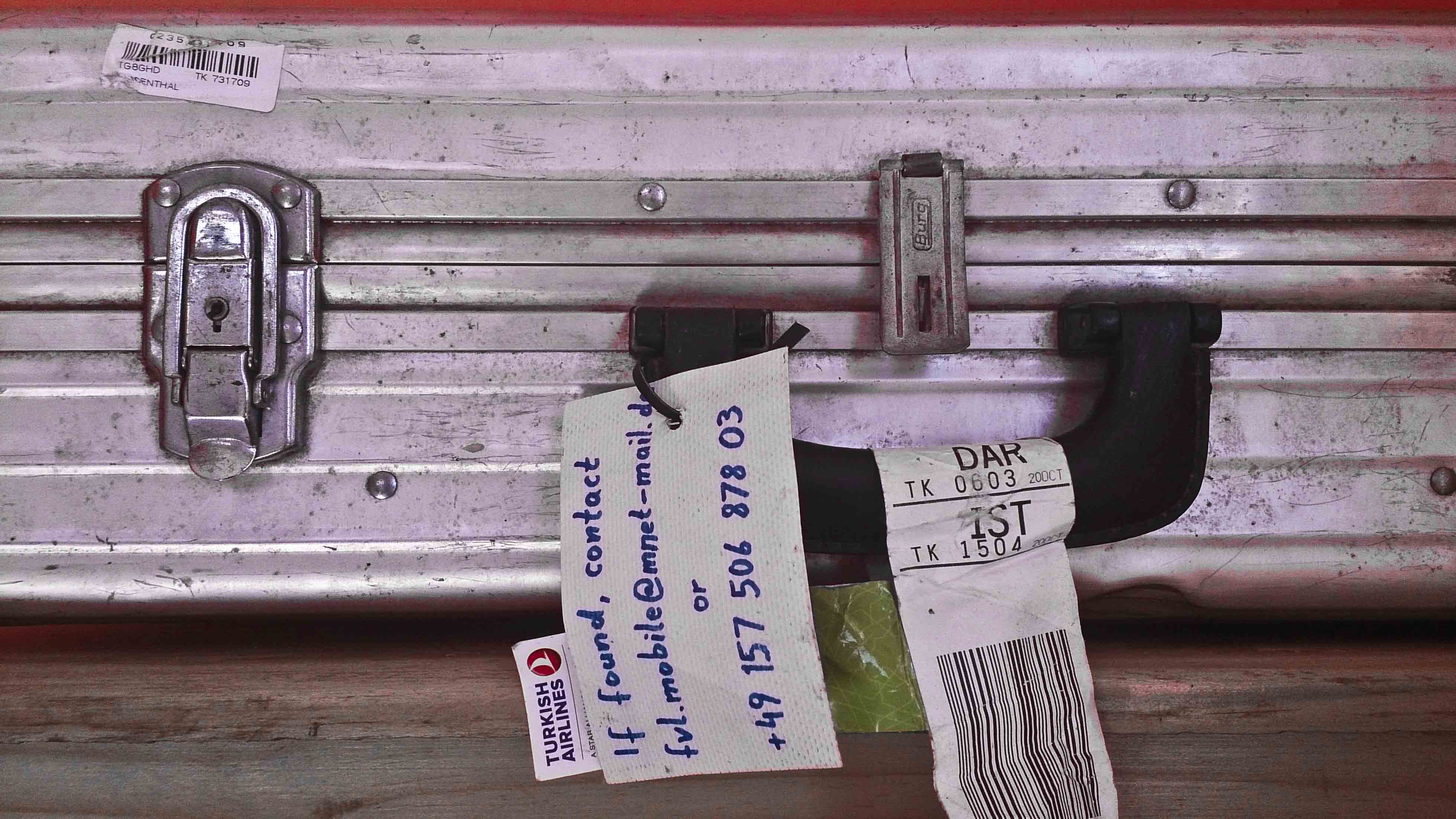Es ist Sonntag, der 2. Advent. G. ist am Morgen nach der Nikolausparty in Ilala wieder nach Magomeni aufgebrochen, weil er sich mit M. von Africraft treffen wollte. G. ist jetzt nämlich zum Produktdesigner aufgestiegen und gestaltet Recycling-Gegenstände für Africraft, eine NGO zur Unterstützung lokaler Handwerker, mit. Das Ganze verzögerte sich aber und so beschloss G., einen kleinen Mittagsschlaf zu halten. Dann machte er sich ein paar Pfannkuchen (eintönig, dachte er sich, immer dieser fettige Teig, aber leider legendär einfach und so lecker). Überhaupt war ihm gestern in der Nierengegend so eine Speckschicht aufgefallen. Das gehörte wohl auch zum Erwachsenwerden dazu. Die Spargelzeit wäre dann vorbei. Egal, zumindest jetzt. Zum Essen hörte G. das Album „Das Leben ist grausam“ von den Prinzen, 90er-Jahre pur. G. war sehr zufrieden. Dann wollte er losfahren. Den Schlüssel hätte er bei den Nachbarn deponieren wollen, doch die waren nicht da, sonst hätte er sich auch noch mit A. für einen Kinobesuch verabreden können. Naja, dachte G., dann gebe ich den Schlüssel eben dem Kioskbesitzer, der ist auch vertrauenswürdig. Statt seiner waren aber nur zwei dubiose Aushilfen im Laden. Den Torschlüssel zu verstecken, kam nicht in Frage, da man als Ausländer in einem traditionellen Viertel fast immer beobachtet wird, nicht einmal argwöhnisch, aber in der Öffentlichkeit ist man in Magomeni einfach wirklich öffentlich. Also ging G. wieder ins Haus, packte den Schlüssel in ein Stück Zeitungspapier, nahm noch einige weitere ablenkende Gegenstände (ein Stück Zimtbaumrinde und irgendeine tropische Nuss) und stopfte alles in eine Plastiktüte, die er der Tochter des Schneiders anvertraute und sie bat, das Päckchen Samuel auszuhändigen. Sie versprach es und G. machte sich auf den Weg, verspätet wie immer. Unterwegs dachte er noch nach, ob er den Schlüssel vielleicht in einem Hefebrötchen hätte verstecken sollen, das wäre noch unauffälliger gewesen, aber dann kam er sich paranoid vor. Außerdem musste er sich konzentrieren, um mit seinem Fahrrad nicht überfahren zu werden. Als er schließlich bei Africraft ankam, war M. noch nicht da, aber ein Arbeiter öffnete ihm und G. begann, an seinem Prototyp für den Anti-Diebstahl-Rucksack mit dem Codenamen ATB DSM (Anti-Theft Bag Dar Es Salaam) zu arbeiten. Dazu konnte er auf eine chinesische Industrienähmaschine zurückgreifen, die mit atemberaubender Geschwindigkeit alles zusammennähte, was ihr unter die Nadel kam. Zumindest, wenn der Unterfaden gereicht hätte, den G. wegen seiner Faulheit beim Aufwickeln zweimal tauschen musste. Zwischendurch kam M. und brachte G. Wasser, sie unterhielten sich kurz, dann musst M. wieder los zum Einkaufen. Nach gut drei Stunden war das Behältnis dann fertig. Der Schneider hätte es sicher besser gekonnt, aber G. hatte ja die Idee gehabt und für die Erklärung einzelner Nähte reichte sein Kiswahili doch nicht ganz. Als dann immer mehr Moskitos G. das Leben zusetzten, fotografierte er im Licht der Neonröhre noch sein Werk und brach wieder auf. Der Arbeiter war gerade dabei, auf einem Feuer Ugali (Maisbrei) zu kochen, aber G. hatte richtigen Hunger und keinen, den er mit Stärkemehl stillen wollte.
Sie verabschiedeten sich herzlich voneinander und G. fuhr los. Den ganzen Weg über dachte er darüber nach, wie er den Rucksack optimieren könne, da der Prototyp noch keineswegs marktreif war. Zu viel Produktionsaufwand bei zu wenig Präzision und Funktion sind leider keine Verkaufsargumente. Auf der Kawawa Road hatte er dann die Idee, die Seitenteile des Rucksacks einzeln zu fertigen und durch Nähte zu verbinden, um die Zugänglichkeit zu den einzelnen aufzunähenden Gurten zu verbessern. Andererseits würde das die Gefahr bergen, dass das Material ausfranst, was bei den verwendeten alten Zement- und Reissäcken kritisch ist. Und der Boden wäre schwächer. Aber wie viel schwächer. Über diese Gedanken hätte G. fast einen Bus gerammt. Auf jeden Fall würden sie Gurte brauchen, denn ein Tragesystem ohne Gurte wäre umständlich und böte keine Vorteile. Irgendwann schloss G. die Akte Rucksack in seinem Kopf. Er brauchte noch Mangos, irgendwelche pikanten Mangos zum Abendessen wären definitiv sehr lecker. Und Zucker brauchten sie auch. G. kaufte beides ein. S. war auch schon zu Hause. L. war auch da, zum Wäschewaschen. Mit dem Schlüssel hatte alles funktioniert. G. war insgesamt überrascht, dass S. angesichts der unsicheren Übergabestrategie nichts gesagt hatte. Vielleicht hätte er doch den Schlüssel in dem Brötchen verstecken sollen? Stattdessen aß der das Brötchen mit Kakao als Nachtisch zu seinem Mangogemüse. Dann loggte G. in seinen Blog ein. Der letzte Eintrag war schon fünf Tage her. Himmel, wie die Zeit vergeht. Schon zehn Uhr abends. Morgen würde wieder der Alltag beginnen. Zu dem bald vielleicht mehr Africraft und mehr Prototypen gehören würden.