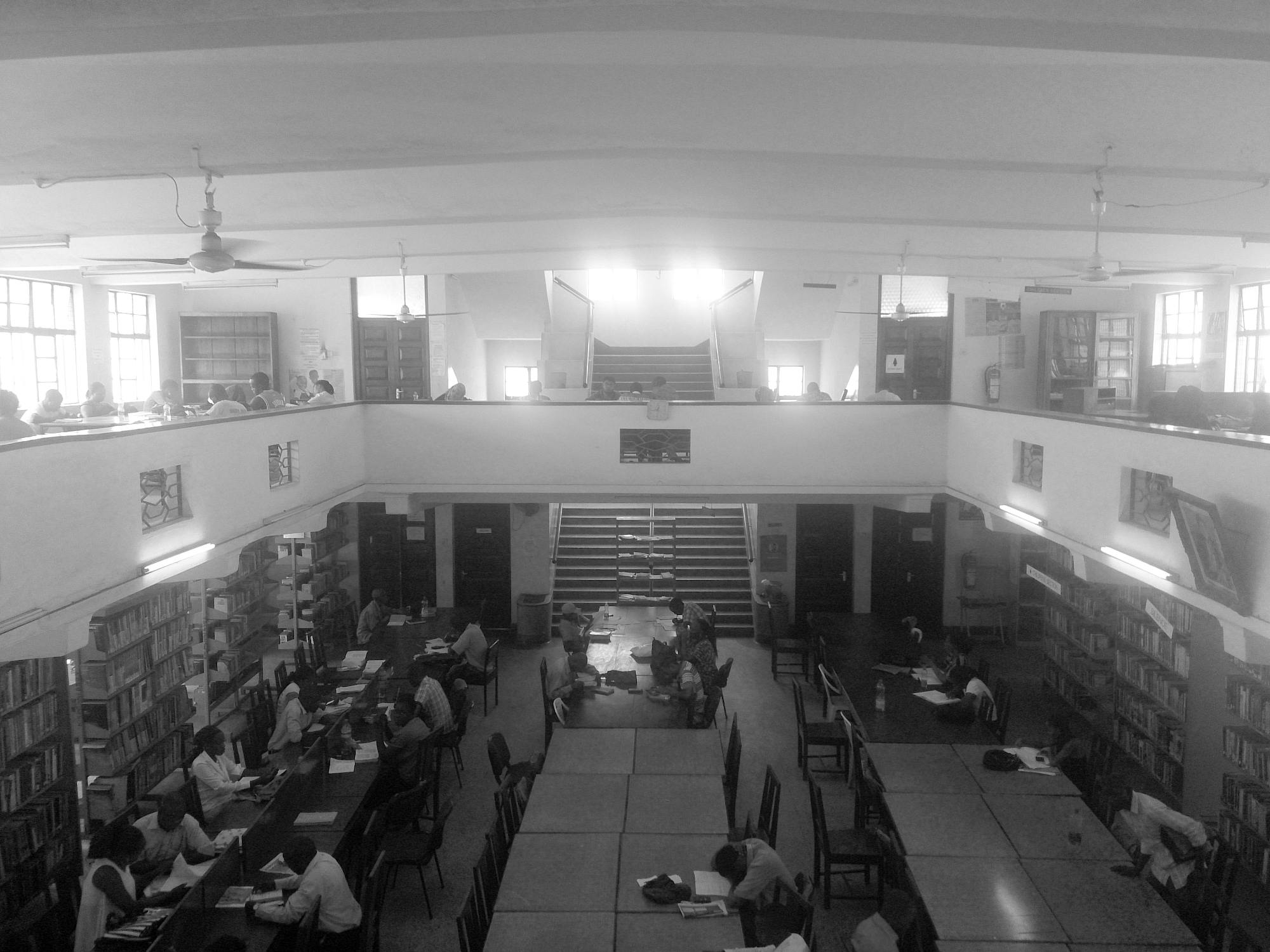Es war Mittwochmorgen, G. saß vor seinem Laptop und schaute nach seinen E-mails. Das Frühstück war noch nicht da. Der Alarm ging los und G. rannte nach draußen. Das Rettungsteam sollte ausrücken. G. und S. griffen ihre Helme, den Erste-Hilfe-Koffer und die Einsatztasche, in der zusätzliche Handschuhe, ein Hohlstrahlrohr und Trinkwasser liegen. Der Rescue Tender fuhr mit einem wunderbar kräftigen deutschen Martinshorn los. Wenn G. diese Sirene hört, ist er immer zuversichtlich. In Dar es Salaam gibt es tausende Sirenen mit verschiedenen Heultönen, gefühlt jeder, der Lust hat, baut eine in sein Auto. Aus Deutschland wusste G. allerdings, dass das Martinshorn das Eintreffen von professionellen Einsatzkräften ankündigt. Und das ist ja schon eine feine Sache. Nun mussten eben G. und seine Kollegen die professionellen Einsatzkräfte stellen. Der Notfall: Eine eingestürzte Hauswand. G. überlegte gemeinsam mit S., was man da unternehmen könnte. Die Autos machten diszipliniert Platz für die Feuerwehr, an manchen Stellen dachte sich G., dass man ein Schulungsvideo für die Rettungsgasse aufnehmen könnte. So erreichte das Fahrzeug nach 20 Minuten den Stadtteil Kawe. An der Stelle, zu der sie von den Anwohnern gewiesen wurden, stand bereits das Auto der Wache Kinondoni. Die Mannschaft marschierte eine lange Treppe hinunter. Als G. hörte, dass es Verletzte gäbe, schickte er zwei Mann zurück, um Tragen zu holen. An der von einer Menschenmenge umringten Einsatzstelle wurde klar, dass man sich über die Methodik der Ausgrabung keine Gedanken mehr machen müsste. Eine Schlamm- und Geröllawine hatte einen Teil eines Wohnhauses verschüttet. Wegen der leichten Bauweise war faktisch nichts mehr davon übrig außer einer Wand und dem Wellblech des Dachs, das man bereits auf die Seite geräumt hatte. Anwohner gruben mit Spaten und Hacken durch den Schutt. Drei Bewohner hatte man bereits tot geborgen. Ein Mädchen wurde vermisst. Die Chance, sie lebend zu bergen, war faktisch nicht vorhanden, denn es gab augenscheinlich keine Hohlräume in den Trümmern. Gs. Idee, die Einsatzstelle zu räumen und systematisch die Trümmer wegzuschaffen, verhallte ungehört. Die Feuerwehr hatte ohnehin kaum Autorität, die Grabung wurde mehrheitlich von den Anwohnern ausgeführt. G. nahm aus Gründen der Außendarstellung ebenfalls eine Hacke zur Hand und begann, Schutt zu durchwühlen, S. half ihm. Inzwischen war auch das Fernsehen eingetroffen und befragte Anwohner und den Einsatzleiter, der in seinem weißen Hemd herumstand und inkompetent wirkte.
So vorschnell zu urteilen, wäre allerdings vermessen gewesen. Es war faktisch klar, dass nichts mehr zu retten war. Zudem war es schwül und beim Einsatzgebiet handelte es sich um das, was Geographen als Marginalsiedlung bezeichnen würden, ein Slum also. Das Risiko, eines vorzeitigen Todes zu sterben, ist dort sehr hoch. Die Anwohner wirkten auf G. erstaunlich gelassen angesichts der Tatsache, dass gerade eine Familie mit Ausnahme der Mutter ihr Leben verloren hatte. Schließlich fand man auch das vermisste Mädchen. Sie lag weich in der Erde. Die gerufenen Ärzte hatten auch ein Leichentuch mitgebracht, das auf die Trage gelegt wurde. Die Leiche wurde noch mit einem bedruckten Stofftuch zugedeckt, dann wurde die weiße Decke darübergeschlagen und der Körper festgeschnallt. G. ging vorne links. Die Trage war leicht und doch kamen die Helfer auf der steilen und engen Treppe ins Schwitzen. Neben dem Krankenwagen wurde die Leiche noch einmal von der Umhüllung befreit und S. stellte den Tod fest. Es war zehn Uhr. Schaulustige zückten ihre Telefone. G. versuchte, sie etwas zurückzudrängen und rief ihnen zu, sie sollten nicht fotografieren. Warum wollten sie mit ihren erbärmlichen, unsinnigen Leben, die sie lebten, weil die Lawine zufällig nicht auf ihre Hütte niedergegangen war, vor ihren Freunden damit prahlen, eine Leiche gesehen zu haben? Wut wallte in G. auf und dann dachte er sich, dass es egal war. Es gab hier wohl dringendere Fragen als Persönlichkeitsrechte und die Seele des armen Kindes weilte wohl ohnehin schon im Jenseits und hatte es nicht mehr nötig, sich über die Sensationslust ihrer Mitmenschen Gedanken zu machen. Also packten die Feuerwehrleute den kleinen Körper und hoben ihn auf die Trage des Krankenwagens. Dann fuhren sie erst in das Militärkrankenhaus von Lugalo, wo allerdings niemand eingeliefert worden war. In einem anderen Krankenhaus warteten sie noch ein wenig, ein Totenschein wurde ausgefüllt und es ging zurück auf die Wache. G. hatte Hunger.
Im Nachhinein fragte sich G., wie seine Gedanken waren. Direkt vor Ort war ihm das meiste surreal erschienen, ein Dokumentarfilm in 3D. Das Kind hätte auch eine Puppe sein können. Und ein bisschen schämte er sich. Da waren also ein paar wirtschaftlich Arme gestorben, fünf von Millionen, um die sich nie jemand gekümmert hatte. Und wenn es dann nichts mehr zu retten gab, kam der Staat mit Feuerwehrleuten, darunter zwei reiche weiße Ausländer in sauberen Uniformen und mit Helmen auf dem Kopf, die ein halbes Jahreseinkommen der Menschen kosteten und zogen eine Leiche aus dem Schlamm. Wahrscheinlich das einzige Mal für das Kind, auf einer Sänfte getragen zu werden. Schade, dass es nichts mehr davon hatte. Persönlich fühlte sich G. nicht traurig oder schuldig, aber er verspürte eine gewisse Hoffnungslosigkeit in sich aufsteigen, dass sich an der grundlegenden Situation bald etwas ändern könnte. Er dachte andererseits, dass diese Bilder perfekt für die Werbung von Spenden wären. Elend und Not in voller Auflösung. Und er dachte daran, wie viel Voyeurismus einfachen Menschen zugemutet wird, die nicht das Glück hatten, mit guten Chancen ins Leben zu starten, nur damit ein paar Europäer vor Weihnachten ihr Wohltätigkeitsbedürfnis befriedigen können, um gleich darauf beim Discounter noch Bananen aus den alten Kolonien und eine neue Spielkonsole mit seltenen Erden für die Kinder zu kaufen. G. hatte noch viele lose Enden in seinen Gedankensträngen und viele Widersprüche. Er war dankbar, dass er hier war, als Privilegierter.